![]() Startseite Verzeichnis
Startseite Verzeichnis
![]() Verzeichnis
Verzeichnis
Erläuterungen zum Gebrauch des Galaxienverzeichnisses
Schreibart und Sprache wurden versucht dem Englischen anzupassen.
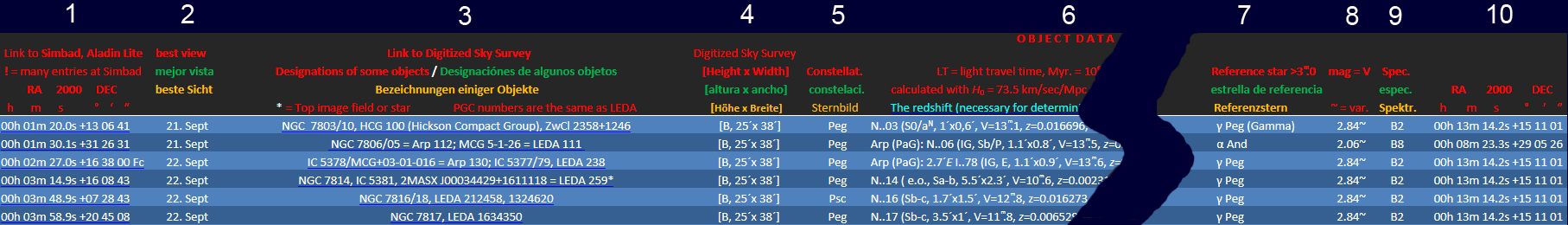
1. Spalte
1. Funktion:
Koordinaten der empfohlenen Aufnahmebildmitte. Auf diesen Koordinaten befindet
sich oft das in der 3. Spalte zuerst aufgeführte Objekt, also beispielsweise die
Koordinaten des 1. Bildfeldes (RA 00h 01m 20s) sind die Position von NGC 7803.
Steht hinter den Koordinaten der Zusatz Fc (Fieldcenter), ist in der Bildmitte
keine helle Galaxie. Hier sollen mehrere Objekte gut verteilt im Bild zur
Abbildung kommen.
Die Koordinatenangaben
stammen von der Datenbank SIMBAD und wurden in RA auf 0,1s und in DE auf 1"
aufgerundet. Die Fc-Koordinaten ermittelte der Autor.
2. Funktion: SIMBAD: Klicken
Sie mit der Maus auf einzelne Koordinaten der 1. Spalte, wechseln Sie zu SIMBAD
und Aladin Lite (Interactive
Aladin Lite view). Es werden Ihnen Basisdaten zu sämtlichen verfügbaren Objekten
in 10´ Umkreis dieser Koordinaten aufgelistet, in Einzelfällen über 3000 aller
Klassen (dauert etwas). Mit so vielen Objekten lässt es sich schlecht arbeiten.
Davor wird gelegentlich gewarnt durch ein "!" hinter den Koordinaten.
Klicken Sie in der
SIMBAD-Seite in die Spalte eines Objekts, geht eine weitere mit den verfügbaren
Daten zu diesem Objekt auf. Dort steht unten auch eine Vielzahl anderer
Katalogbezeichnungen. Dies ist insofern wichtig, weil der Autor aus Platzgründen
oft kürzere Bezeichnungen verwendete als SIMBAD primär anzeigt. Viele schwache
Galaxien sind aber überhaupt nur mit NED zu identifizieren. Bitte beachten Sie,
dass der Autor unter "Objektdaten" (Spalte 6) kaum Angaben von SIMBAD benutzte.
2. Spalte
"beste Sicht" steht für den Tag der längsten Beobachtbarkeit. Gemeint
ist der Kalendertag, an dem die Kulmination des Aufnahmefeldes um Mitternacht
eintritt. Der Zeitpunkt wurde ungefähr (+- 1
Tag) mit einer drehbaren Sternkarte ermittelt, abgestimmt auf die geographische
Länge von Berlin (ca. 1,5 Längengrade westlich des Zeitzonenlängengrades 15°
Ost). Wenn diese Relation berücksichtigt wird, sind die Angaben weltweit, also
in jeder Zeitzone, verwendbar. Weicht die Länge des Beobachtungsortes
innerhalb der Zeitzone hiervon deutlich ab, muss beachtet werden, dass
mit jedem Längengrad westlicher die Kulmination um Mitternacht einen Tag später
eintritt, jeder Längengrad östlicher einen Tag früher!
Will man beispielsweise
die Angaben des Verzeichnisses in der Sierra Nevada in Spanien benutzen, wo
ebenfalls die MEZ gilt, die Länge aber etwa 3° West ist, wird die Kulmination um
Mitternacht erst 16 oder 17 Tage später eintreten!
3. Spalte
1.
Funktion: Namen und Katalogbezeichnungen einiger heller und auch besonders
ferner identifizierbarer Objekte im Aufnahmefeld. Oft werden diese durch
Schrägstriche abgekürzt, z.B.: IC 1642/46, LEDA 4370/92 = IC 1642, IC 1646, LEDA
4370, LEDA 4392 oder der Katalogname
wird bei nachfolgen Objekten weggelassen, z.B. LEDA 85298, 1298602, 3091891 =
LEDA 85298, LEDA 1298602, LEDA 3091891.
Entsprechend der
SIMBAD - Datenbank wurden keine PGC - Bezeichnungen verwendet. Diese tragen nämlich
die gleichen Nummern wie LEDA (mit wenigen Ausnahmen).
Findet sich am Ende der
Objektbezeichnungen ein Sternchen *, handelt es sich (zumindest für den Autor)
um eines der schöneren und interessanteren Bildfelder und sollte bei der
Auswahl unbedingt beachtet werden. Ein Sternchen innerhalb der
Objektbezeichnungen weist auf einen hellen Stern im Bildfeld hin.
Findet sich am Ende einer
Objektbezeichnung ein hochgestelltes ᴺ, ist dieses Objekt bei SIMBAD nicht
verzeichnet und ist NED entnommen.
2. Funktion: Die
Objektbezeichnungen sind mit einem Link zum "Digitized Sky Survey" versehen, wo
der betreffende Himmelsausschnitt eingesehen werden kann. Die Aufnahmen stammen
von der berühmten Palomar - Himmelsdurchmusterung (POSS II) und wurden auf analogen
Fotoplatten belichtet und später digitalisiert. Aufnahmeinstrument war das 48
Zoll Palomar Oschin - Schmidt - Teleskop mit 1220/1830/3050 mm
(Öffnung Schmidtplatte/Durchmesser Spiegel/Brennweite, 1:2,5).
4. Spalte
Ergänzende Informationen zu den Links der 3. Spalte ("Digitized Sky Survey"): 1.
Farbempfindlichkeit der angezeigten analogen Plattenaufnahmen, B = Blau, R =
Rot, 2. Winkelgröße des angezeigten Bildfeldes in Bogenminuten.
5. Spalte
Übliche Abkürzungen für die Sternbilder in dem oder in denen das
Aufnahmefeld liegt.
6. Spalte
7. Spalte
8. Spalte
9. Spalte
10. Spalte
Unter "Objektdaten" finden sich abgekürzte Informationen (siehe
Abkürzungen) für meist 4 bis 5 Galaxien, vom Platz sehr begrenzt. Am Anfang
stehen meist der Winkelabstand und die grobe Himmelsrichtung (kursiv) in der
sich ein Objekt von der Bildmitte entfernt befindet (Norden ist oben und Osten
ist immer links). Abstände >10´ wurden vom Autor am Bildschirm ausgemessen und
sind ungenauer. Tipp: Richten Sie zur besseren Orientierung die Bildachsen Ihrer
Aufnahmen auf die Himmelsrichtungen aus.
Die Objektbezeichnungen (siehe Spalte 3) wurden z.B. wie folgt abgekürzt:
NGC 7806 = N..06, LEDA 1950019 = L..19, 6dFGS gJ203220.5-020828 = 6d..28.
In Klammern folgt meist der Galaxientyp (bei elliptischen Galaxien
Feinunterteilung weggelassen), die Winkelausdehnung und die Totalhelligkeit
(V = visuell, B = Blauhelligkeit, g = Grünhelligkeit - SDSS - Standard,
λ
490 nm und in
wenigen Fällen R = Rothelligkeit). Die Galaxien sind in der Regel im Blauen zwischen 0,6 und 1 Größenklasse
schwächer als im Visuellen (Farbenindex). Nimmt man 0,8 mag an, hat man einen
guten Anhaltspunkt zur Umrechnung.
Die Totalhelligkeiten, im Zusammenhang mit der Winkelausdehnung
stehend, sind messtechnisch an eine Grenzisophote
geknüpft. Als Fotograf interessiert mich eher die erkennbare Ausdehnung der Objekte im Digitized Sky Survey,
die oft deutlich größer ist. Aus diesem Grund hat der Autor mit
Aladin Lite die Winkelgrößen immer öfter versucht selbst zu bestimmen (hochgestelltes
ᴬ
= Quelle Autor). Mitunter wurden so auch fehlende Angaben in den Datenbanken
ergänzt. Es ist natürlich klar, dass durch vergrößerte Winkelausdehnungen die
Totalhelligkeiten (auf 1◻" aufintegrierte Gesamthelligkeiten) mit den Angaben in
den Datenbanken nicht mehr exakt korrelieren (müssten etwas heller sein).
Hinter den Helligkeiten findet sich, wo bekannt oder aus Platzgründen machbar,
die Rotverschiebung z. Diese wurde nicht wie üblich heliozentrisch angegeben,
warum? Die 3K-Hintergrundstrahlung ist in Sachen Raumexpansion das universelle Inertialsystem. Dank genauer Satellitenmessungen weiß man heute, dass wir uns
mit ca. 620 km/s in eine Richtung gegen die 3K-Hintergrundstrahlung bewegen. Der
Autor verwendete daher korrigierte Rotverschiebungen von NED, in denen diese
Bewegung herausgerechnet wurde. Die Trefferwahrscheinlichkeit einer annähernd
richtigen Lichtlaufzeit ist hierüber statistisch am wahrscheinlichsten. Leider kennen wir in der Regel die Eigengeschwindigkeit der Galaxien im Raum
nicht und erhalten lediglich eine Schätzung der Lichtlaufzeit, in dem wir z allein als Raumexpansion deuten. In dichten Galaxienhaufen kann die
Eigengeschwindigkeit aber bis zu 1000 km/s erreichen. Vor allem bei nahen
Objekten ist die Unsicherheit extrem groß. Daher verwendete der Autor hier oft
Entfernungsangaben von Wikipedia (dort z meist korrigiert auf das galaktische
Zentrum).
Nach z steht LT (light travel time) = Lichtlaufzeit. Diese Angaben wurden
aus z mit dem "Ned Wright´s Javascript Cosmology Calculator" berechnet. Als
Hubble-Parameter H0 verwendete der Autor ein erstes Ergebnis aus Gaia - Daten:
73,5 km/s/Mpc, was im Widerspruch zu den Ergebnissen der Kosmologie - Raumsonden WMAP und Planck steht H0
ist offensichtlich keine Konstante.) Weitere Parameter
der LT-Rechnungen waren: Materiedichte 0,27, Vakuumenergiedichte 0,73, ein
flaches Universum.
Steht LT hinter einer Klammer, gilt diese Lichtlaufzeit gemeinsam für zwei zuvor
aufgeführte Galaxien.
Wenn Sie dazu neigen, die Lichtlaufzeit wie selbstverständlich als Entfernung in
Lichtjahren zu verstehen, bedenken Sie bitte folgendes: In einem beschleunigt
expandierenden Universum wird die Gleichsetzung von Lichtlaufzeit und Entfernung
mit zunehmender Rotverschiebung immer absurder! Die Lichtlaufzeit ist im
Idealfall gleich der Strecke in Lichtjahren, die das Licht zu uns zurückgelegt
hat. Dies ist aber weder die Entfernung des Objekts als das Licht auf Reisen
ging, weder die heutige Entfernung, noch ist es die Zeit, die ein Lichtsignal
jetzt dorthin bräuchte. Nur in kosmologischer Nähe zu unserer Milchstraße (bis ca.
z = 0,1, Lichtlaufzeit etwa 1,2 Milliarden Jahre) ist diese vereinfachte Sicht, in
Anbetracht der Unsicherheiten, hinnehmbar.
Quellenangaben:
Messier-, NGC- und IC-Objektangaben (Typ, Winkelgröße, Helligkeit) entstammen
dem NGC/IC - Project, sofern kein hochgestellter Buchstabe auf etwas anderes
verweist (Verzeichnis von Dr. Wolfgang Steinicke, stand März 2018/19).
Die 3K-korrigierten Rotverschiebungen sind NED entnommen (bis auf wenige
Ausnahmen). Angaben zu schwächeren Objekten, Haufen und Quasaren sind ebenfalls
NED (NASA/IPAC Extragalactic Database), der weltweit größten extragalaktischen
Datenbank, entnommen.
Abweichungen davon wurden generell durch hochgestellte Buchstaben kenntlich
gemacht
(ˢ, ᴺ, ʷ, ᴬ , ᴾᴳᶜ, ᴺᴵ - siehe Abkürzungen).
Die Angaben zu hellen Sternen stammen von SIMBAD (SIMBAD Astronomical Database -
CDS Strasbourg).
Referenzsterne: Helle Sterne (>3mag) zur Aufsuchhilfe der
Aufnahmekoordinaten. Die verwendeten altgriechischen Buchstaben wurden
gelegentlich in Klammern ausgeschrieben.
visuelle Helligkeiten der Referenzsterne (Quelle: SIMBAD), ~ bedeutet
veränderlicher Stern
Spektraltypen der Referenzsterne (Quelle: SIMBAD)
Koordinaten der Referenzsterne (Quelle: SIMBAD), in RA auf 0,1s und
in DE auf 1" aufgerundet